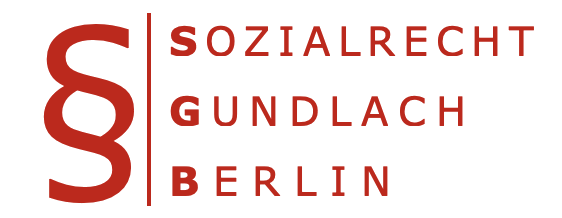Anwaltskosten im Sozialrecht
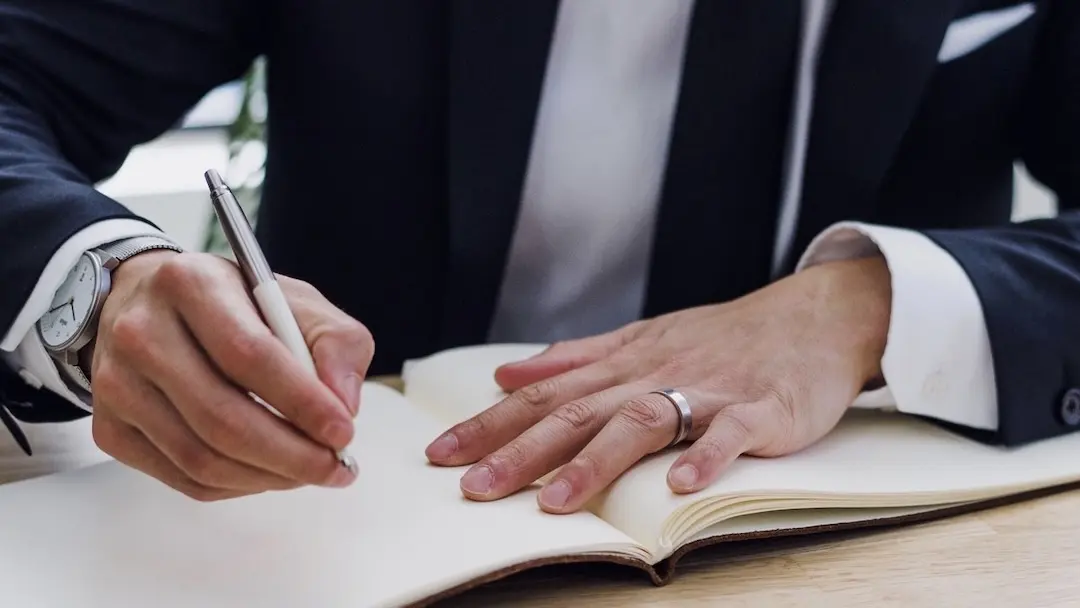
Was ein Anwalt für Sozialrecht kostet
Eine „standartmäßige“ anwaltliche Antwort auf die Frage nach seinen Kosten wäre: „Die Anwaltskosten im Sozialrecht variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab“ – damit ist der Mandant aber leider nicht ein Stück schlauer (…aber der Anwalt auf der rechtlich sicheren Seite). Um besser verstehen zu können, wie sich Anwaltskosten berechnen, muss aber tatsächlich etwas weiter ausgeholt werden.
Dabei geht es zunächst einmal darum zu klären, auf welcher Grundlage die Anwaltskosten berechnet werden sollen. Die Grundlage der Berechnung kann nämlich im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) liegen, aufgrund einer Vergütungsvereinbarung erfolgen oder in speziellen Fällen durch eine Pauschalvereinbarung bzw. nach einem Erfolgshonorar abgegolten sein. All diese verschiedenen Grundlagen der Berechnung der Anwaltsgebühren führen dann nämlich zu einem anderen Preis.
Es empfiehlt sich daher vorab mit seinem Anwalt für Sozialrecht über die voraussichtlichen Kosten zu sprechen und gegebenenfalls eine Vergütungsvereinbarung zu vereinbaren um Transparenz zu gewährleisten.
Grundlagen der Anwaltsgebühr
Wie sich die Anwaltsgebühren berechnen lassen
Zuerst muss die Berechnungsgrundlage der Anwaltskosten zwischen Mandant und Anwalt vereinbart werden. Diese bestimmt dann nämlich maßgeblich die Berechnung der Vergütung. Manche Berechnungsgrundlagen sind selbsterklärend, mache (vor allem das RVG) splitten die Anwaltsvergütung in viele Teile auf, die für Mandanten nicht wirklich gleich offensichtlich einsichtig sind.
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Das RVG ist die standardmäßige gesetzliche Grundlage für die Berechnung und Abrechnung der Vergütung von Rechtsanwälten in Deutschland. Gibt es keine besondere Vereinbarung zwischen Anwalt und Mandant so gilt das RVG. Zwar soll das RVG für Transparenz und Berechenbarkeit der Anwaltskosten sorgen… …dies darf aber inzwischen ob seiner Kompliziertheit bezweifelt werden.
Pauschalvergütung
Bei einer Pauschalvergütung wird für eine bestimmte Leistung ein fester Betrag vereinbart. Dabei ist wichtig, dass Mandant und Anwalt den Umfang dieser bestimmten Leistung (für den die Pauschale gezahlt werden soll) genau verstehen und vertraglich festlegen. Zudem ist eine Vereinbarung zu einem niedrigeren Preis als der gesetzlichen Vergütung nach dem RVG nur in Ausnahmefällen möglich. Die Zahlung der Pauschale erfolgt immer unabhängig vom Ausgang des Verfahrens und zumeist auch zu Beginn der Tätigkeit des Anwalts.
Vergütungsvereinbarung
Eine Vergütungsvereinbarung ist eine individuelle, vertragliche Vereinbarung zwischen Mandant und Rechtsanwalt über die Höhe und die Art der Vergütung. Die beiden klassischen Vergütungsvereinbarung sind dabei die Vereinbarung zur Abrechnung nach einem Stundensatz oder nach einer pauschalen Erhöhung der Gebühren des RVG. Eine Vergütungsvereinbarung ist zumeist flexibler als das RVG und schafft über seine schriftliche Fixierung Klarheit und Transparenz.
Erfolgshonorar
Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars zwischen Mandant und Rechtsanwalt ist in Deutschland grundsätzlich verboten, aber in eng definierten Ausnahmefällen zulässig (vgl. § 4a RVG). Eine dieser Ausnahmen liegt vor, wenn der Mandant im Einzelfall bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten werden würde. Im Sozialversicherungsrecht dürfte dieser Fall nur äußerst selten anzutreffen sein.
Kosten einer Erstberatung
Welche Anwaltsgebühren bei einer Erstberatung anfallen
Die Kosten sind gesetzlich auf maximal 190,00 € zzgl. Umsatzsteuer begrenzt, wenn Sie eine Privatperson und kein Unternehmer sind. Die Rechnung für eine Erstberatung beträgt daher 226,10 €. Es kommt dabei nicht darauf an wie schwierig oder wie umfangreich die Fragen zu Ihrem Fall sind bzw. auch nicht, wie lang das Erstgespräch war.
Kosten der außergerichtlichen Vertretung
Welche Anwaltsgebühren bei einer außergerichtlichen Vertretung anfallen
Berechnet sich die Vergütung des Anwalts nach einem Stundensatz, dann wird entsprechend der Zeitaufwand des Anwalts für die außergerichtliche Tätigkeit bezahlt. Bei einer Pauschalvergütung wäre diese Pauschale dann fällig.
Berechnet sich die Vergütung des Anwalts nach dem RVG, so wird für eine außergerichtliche Tätigkeit gegenüber einem Gegner eine sog. Geschäftsgebühr fällig. Zu dieser Geschäftsgebühr kommt dann noch die Auslagenpauschale und die Umsatzsteuer hinzu. Aber das RVG kennt noch weitere Gebühren die der Rechtsanwalt zusätzlich zur Geschäftsgebühr für seine außergerichtliche Tätigkeit verdienen kann: Dies wären z.B. eine Hebegebühr, welche für die Auszahlung oder Rückzahlung von entgegengenommenen Geldbeträgen erhoben wird. Oder eine Aussöhnungsgebühr, eine Erledigungsgebühr, usw..
Nur bei einer Pauschalvergütung für die gesamte außergerichtliche Tätigkeit weis der Rechtsanwalt bei Beginn seiner Tätigkeit, was dem Mandant in Rechnung zu stellen ist. Bei Beginn kann nämlich nicht zu 100% verlässlich der Zeitaufwand geschätzt werden. Ebensowenig weis der Anwalt am Anfang, welche Gebühren aus dem RVG er am Ende verdient haben wird. Entsprechend kann man dann auch nicht vorab einen Preis nennen.
Kosten der Vertretung vor Gericht
Welche Anwaltsgebühren bei einer Vertretung vor Gericht anfallen
Auch hier gilt: Berechnet sich die Vergütung des Anwalts nach einem Stundensatz, dann wird entsprechend der Zeitaufwand des Anwalts für die gerichtliche Tätigkeit bezahlt. Bei einer Pauschalvergütung wäre diese Pauschale dann fällig.
Berechnet sich die Vergütung des Anwalts nach dem RVG, so wird für eine gerichtliche Tätigkeit eine sog. Verfahrensgebühr fällig. Zu dieser Verfahrensgebühr kommt dann auch wieder die Auslagenpauschale und die Umsatzsteuer hinzu. Bei einer gerichtlichen Tätigkeit kennt das RVG auch noch weitere Gebühren wie bei der außergerichtlichen Tätigkeit, ähnlich wie bei der außergerichtlichen Vertretung. Die eindringlichste ist dabei sicherlich die Terminsgebühr für einen Termin vor dem Gericht. Wobei das RVG jedoch Umstände kennt, bei denen der Rechtsanwalt eine Terminsgebühr verdient, ohne das jemals ein Termin stattgefunden hat…
Wieder erscheint es für Mandanten vorteilhaft, für eine gerichtliche Tätigkeit eine Pauschalvergütung getroffen zu haben. Dies würde aber für den Anwalt bedeuten, dass dieser das Risiko trägt, das die gerichtliche Tätigkeit zu umfangreich wird und damit die Pauschale nicht angemessen ist. Auch hier gilt daher, dass ein Preis nicht vorab genannt werden kann, da weder der schlussendliche Zeitaufwand bei einer Stundensatzvergütung noch das Entstehen aller Gebühren aus dem RVG vorab vollkommen verlässlich bestimmt werden können.
Vertretungsgebühr
Diese Gebühren erhält ein Rechtsanwalt, dem ein unbedingter Auftrag als Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigter, als Beistand für einen Zeugen oder Sachverständigen oder für eine sonstige Tätigkeit in einem gerichtlichen Verfahren erteilt worden ist. Es muss also zur Abgrenzung zur außergerichtlichen Tätigkeit hier eine Prozess vor Gericht stattfinden.
Erledigungsgebühr
Wenn der Anwalt eine über die Einlegung und Begründung des Widerspruchs oder der Klage hinausgehende besondere Tätigkeit entfaltet und sich dadurch eine Rechtssache ganz oder teilweise nach Aufhebung oder Änderung des mit einem Rechtsbehelf angefochtenen Verwaltungsakts durch die anwaltliche Mitwirkung erledigt, verdient der Anwalt eine Erledigungsgebühr. Wie man dem Bandwurmsatz anmerkt: alles hierzu ist umstritten – und dann wäre da noch die Einigungsgebühr…
Terminsgebühr
Die Terminsgebühr entsteht zunächst einmal wie der Name vermuten lässt für die Wahrnehmung von gerichtlichen Terminen. Sie entsteht aber eben zum Beispiel auch in einem Verfahren, für das eine mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist, im Einverständnis mit den Parteien ohne mündliche Verhandlung entschieden wird. Oder in einem Verfahren, für das mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist, wenn dieses nach angenommenem Anerkenntnis ohne mündliche Verhandlung endet.
Auslagenpauschale
Die Auslagenpauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen ist höchstens 20,00 € oder mindestens 20 % der Geschäfts- bzw. Verfahrensgebühr. Das RVG kennt darüber hinaus noch weitere Auslagengebühren, wie eine Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten, welche hier nur exemplarisch genannt werden soll.
Häufige Fragen – FAQ
Kann man mit Ihrer Kanzlei eine Pauschalvergütung vereinbaren?
Grundsätzlich: ja, durchaus!
Die Höhe einer Pauschalvergütung hängt aber vom jeweiligen Fall ab. Eine Entschätzung zur Höhe der Pauschalvergütung wird daher erst nach einem Erstgespräch möglich sein, aufgrund dessen sich Aufwand und Umfang des Falles abschätzen lassen. Grundsätzlich wird dann für jede Verfahrensstufe (Antrag-Widerspruch-Klage) eine Pauschale vereinbart werden können.
Wann erfährt ein Mandant von den Anwaltskosten?
Eine erste, aber nicht abschließende Einschätzung der Anwaltskosten wird schon bei der Beauftragung möglich sein. Wenn jedoch nach RVG (oder nach Stundensätzen) abgerechnet wird, wird es sich jeder Anwalt offen behalten wollen, wie hoch die Schlussrechnung sein wird. Dies liegt schlicht daran, dass nicht vorab sicher ist, welche Gebühren nach dem RVG entstehen werden (oder wie viele Stunden der Anwalt braucht). Auch kann sich der Auftrag an den Rechtsanwalt während des Mandats verändert, so dass die erste Einschätzung nicht mehr aktuell ist.
Welche Anwaltskosten übernimmt die Rechtsschutzversicherung?
Im Allgemeinen tragen Rechtsschutzversicherung die Schwellengebühren (bzw. Schwellensatz) nach dem RVG. Sieht das RVG eine Erhöhung dieses Satzes vor, weil der Fall aus Sicht des Anwalts umfangreich oder schwierig war, so sind Rechtsschutzversicherungen davon selten zu überzeugen. Interessanter ist jedoch in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Rechtsschutzversicherung schon im außergerichtlichen Verfahren greift oder erst wenn Klage eingereicht wird. Ebenso sollte auch immer die Selbstbeteiligung beachtet werden. Rechtsschutzversicherung sind daher selten „Vollkasko“-Rechtsanwaltskostenversicherungen.
Wer muss die Anwaltskosten bezahlen?
Grundsätzlich immer der Mandant. Denn der Vertrag des Rechtsanwalts besteht zu seinem Mandanten. Sollten andere für die Rechtsanwaltskosten aufzukommen haben (der Gegner oder die Rechtsschutzversicherungen) stellt dies eher eine Frage der Ab- bzw. Aufrechnungsform dar. Der Rechtsanwalt wird jedoch nicht das Risiko tragen wollen, ob der Gegner seines Mandanten zahlungsunfähig ist womit dann der Rechtsanwalt auf seinen Kosten sitzen bleibt soll. Daher: Grundsätzlich immer der Mandant.
Warum muss man einen Vorschuss für den Anwalt zahlen?
Der Rechtsanwalt kann von seinem Auftraggeber (dem Mandanten) für die entstandenen und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vorschuss fordern, § 9 RVG. Der Vorschuss für den Anwalt ist also tatsächlich gesetzlich gereglt. Dabei muss man beachten, dass manche Fälle bis zum Abschluss der Berufung oder Revision JAHRE dauern. Hätte der Anwalt nicht die Möglichkeit eines Vorschusses dann arbeitet er schlechtestenfalls sehr lange ohne überhaupt irgendeine eine Zahlung zu erhalten.
Weshalb steigen Anwaltskosten immer weiter an?
Dies liegt daran, dass die Vergütung eines Anwalts nach Abschnitten erfolgt und in diesen Abschnitten wieder unterschiedliche Gebühren anfallen können. Im Sozialversicheurngsrecht entstehen daher für den Antrag bei einem Sozialversicherungsträger zunächst schon Gebühren. Ebenso dann für das Widerspruchs- und ein mögliches Klageverfahren. Dort haben wir dann wieder die Möglichkeit der Terminsgebühr, der Erledigungsbegüht, etc.. Dies führt also zu einem Anstieg der Gebühren und damit der Rechtsanwaltskosten.